8
9
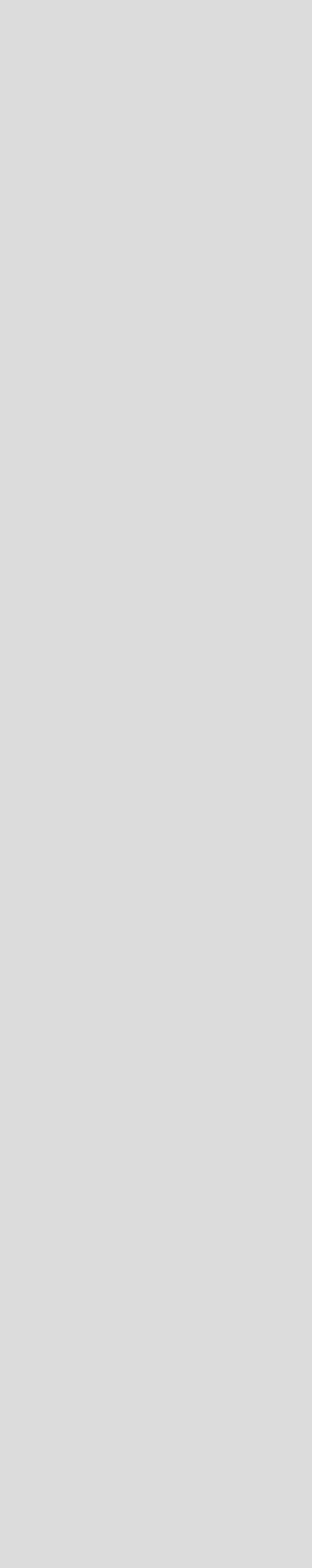
Futtern nicht bei Muttern: die neue Mensa
"Der Steuerzahler bezahlt das Essen, und die Schüler kotzen es ihm ins Gesicht!"




In der Rekordzeit von zwei Monaten hat der Landkreis Mayen-Koblenz eine neue Mensa im Andernacher Schul-
zentrum errichtet - sie musste pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahrs fertig werden. Nur so kann die auf das
Doppelte angewachsene Zahl von Ganztagsschülern des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums verpflegt werden. Bis-
her speisten 60 Ganztagsschüler im Betriebsrestaurant einer Klinik. Für 120 Schüler wäre dort kein Platz mehr
gewesen. Wegen des Zeitdrucks entschied sich der Kreis für einen Fertigbau, der von einem Spezialisten hoch-
gezogen wurde. Für den 1,6 Millionen Euro teuren Modulbau gab es Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm II
des Bundes.
Die Kantine wächst mit
Dem zweigeschossigen Gebäude sieht man nicht an, dass es ein Fertigbau ist. Zwei Mahlzeiten stehen zur Aus-
wahl; der Schulträger fördert die Essenspreise. Die Gerichte kommen von einem Catering-Service und werden in
der Küche erwärmt und portioniert. Richten auch die anderen Schulen des Zentrums Ganztagsangebote ein und
behauptet die Kantine sich gegen die Konkurrenz der Dönerbuden, kann das Gebäude um ein weiteres Stockwerk
erweitert werden und bis zu einer Kapazität von 800 Plätzen wachsen.
Wettbewerb um Neubürger wird härter
Laut dem Landrat stärkt die Kantine den Schulstandort Andernach, weil sie hilft, Familie und Beruf zu verein-
baren: "Berufstätige Eltern können sicher sein, dass ihr Kind regelmäßig ein ordentliches Mittagessen bekommt."
Obwohl der Schulentwicklungsplan des Kreises vorhersagt, dass - mit Ausnahme der Gymnasien - Andernachs
Schulen massiv Schüler verlieren, sieht der Landrat die Situation in Andernach als "stabil" an. Die "Zentralität der
Stadt" ist ihm zufolge nicht gefährdet. Das Schulangebot sei groß und werde durch die Mensa noch attraktiver.
Der Kreischef rechnet damit, dass es in zehn Jahren nur noch Ganztagsschulen gibt.
Ein Projekt wie die neue Schulmensa zeigt, dass der Konkurrenzkampf der Kommunen, vor allem um Familien mit
Kindern, immer härter wird. Auch Andernach ist ein Kaninchen, das die Schlange "demografischer Faktor" - immer
mehr alte, immer weniger junge Menschen - anstarrt, dabei aber nicht erstarren darf. Da ist die Hilfe des Land-
kreises wertvoll, der seit 2008 fast 50 Millionen Euro in seine Schulen investiert hat.
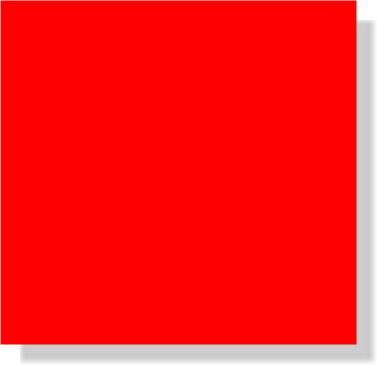
Schlecht.
Für Andernach.
Die Schülerzahlprognosen.

Trotzdem gut.
Landkreis Mayen-Koblenz.
www.kvmyk.de
Landkreis Mayen-Koblenz.
www.kvmyk.de
- Anzeige -

"Die Werbung ist ja
geklaut!"
Andernach tut alles Mögliche - und Unmögliche
Auf anderen Konkurrenzfeldern, wie Wirtschaft und Tourismus, wo die Stadt selbst handeln muss, ist nicht alles
Gold, was glänzt. Der Wunsch der Verwaltung, Käuferströme nach Andernach zurückzulenken, führte dazu, dass
sich Fachmarktzentren mit zu viel innenstadttypischem Sortiment an der Koblenzer Straße breitmachen konnten.
Das schwächte den Handel in der Altstadt, der jetzt durch die Stadthausgalerie gewaltsam reanimiert werden soll.
Die ehrgeizige Vermarktung des Namedyer Geysirs bescherte den Andernachern beträchtliche Schifffahrtskosten
und ein millionenschweres Erlebniszentrum, das im schlimmsten Fall ein dauerhafter Zuschussbetrieb sein wird.
Im ersten Betriebsjahr - es umfasste noch keine volle Saison - schloss die Geysir-Gesellschaft der Stadt mit einem
Minus von 229.000 Euro. Im Jahr darauf reduzierte sich der Fehlbetrag auf 113.000 Euro; auch in den Folgejahren
blieb es bei Verlusten. Ziel muss ein kostenneutraler Betrieb sein, fordern nicht nur die Stadtratsmitglieder
unisono.*
Naturnah und schulfern
Auch bei der Vermarktung von Neubaugebieten lässt die Stadt sich nicht lumpen. Sie hat den Löwenanteil der
Grundstücke im Baugebiet "Pönterberg II" im Stadtteil Kell erworben, um Bauplätze zügig und (fast) zum Selbst-
kostenpreis veräußern zu können. Attraktive Schulen und attraktives Bauland gehören sicherlich zusammen.
Allerdings hat Kell keine Schule und liegt von der Kernstadt und ihren Schulen kilometerweit entfernt. Viele Ein-
wohner bezweifeln daher die Notwendigkeit eines weiteren Neubaugebiets, haben sogar erfolglos gegen den
Bebauungsplan geklagt. Doch die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass es eine "stabile Nachfrage" nach Bau-
plätzen in dem Dorf gibt. Sie will dort unbedingt junge Familien (und neue Steuerzahler) ansiedeln, auch wenn
Eigenheim-Ghettos auf dem Land wegen der langen Wege ökonomisch und ökologisch nachteilig sind, die Land-
schaft zersiedeln - durch Überbauung gehen in Deutschland täglich 60 Hektar Fläche, rund 85 Fußballfelder, ver-
loren - und die Vereinzelung, das Sich-Abschotten im eigenen Haus, befördern. Hinzu kommt die dürftige Optik
der "Kampa-Kisten", wobei die Häuslebauer oft unter dem Diktat der Bauindustrie stehen. Ein zusätzlicher Nach-
teil ist die Klimabilanz: Kein Haustyp verbraucht mehr Energie als ein freistehendes Eigenheim. Daher verwundert
es nicht, wenn die Grünen in einem Hamburger Stadtbezirk den Bau von Einfamilienhäusern verbieten wollen. In
Großstädten, wo der Platz knapp ist, ist das absolut vernünftig. Vernünftig wäre auch, das Wohnen in der Stadt
wieder bezahlbar zu machen, indem Städte genug Bauland ausweisen und die Stadtflucht aufhalten. Diese führt
zur Versiegelung von Grünflächen und langen Pendlerfahrten. Die (Sehn-)Sucht nach Eigenheimen ist so toxisch,
weil sie der Allgemeinheit schadet, aber das allgemeine Glücksstreben repräsentiert wie keine andere Sucht -
der Süchtige will daher partout nicht von ihr lassen.
Nachverdichtung statt Umlandvernichtung
Im Andernacher Stadtrat regt sich zunehmend Widerstand gegen die weitere Umwandlung landwirtschaftlicher
Flächen am Stadtrand in neues Bauland. In erstaunlicher Einigkeit stimmen die Stadträte der Grünen und der
FDP das Hohe Lied der Nachverdichtung an. Beide wollen urbane Quartiere in Zentrumsnähe schaffen, der kurzen
Wege willen und um den Flächenfraß zu stoppen. Doch freier Platz ist hier Mangelware. Eine Ausnahme bildete
bis vor kurzem das städtische Grundstück am Ernestus-Platz, gegenüber dem Koblenzer Tor, welches als Parkplatz
für das Krankenhauspersonal diente - bis die Stadt es zum Gegenstand eines Investorenwettbewerbs für ein ge-
mischt genutztes Quartier machte. Dabei sollte der Bieter mit dem besten Konzept, nicht mit dem besten Preis-
angebot, zum Zug kommen, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Als Sieger ging die Volksbank Rhein-Ahr-
Eifel aus dem Wettbewerb hervor. Sie darf jetzt am östlichen Eingang zur Innenstadt einen Komplex mit Arzt-
praxen, Wohnungen und Gewerbe errichten. Das Quartier könnte, wie der Neubau eines Stadtmuseums am
westlichen Ende der Hochstraße, dem Stadtzentrum einen neuen Schub verleihen. Dann wäre in der Bäcker-
jungenstadt doch so manches Gold, was glänzt...
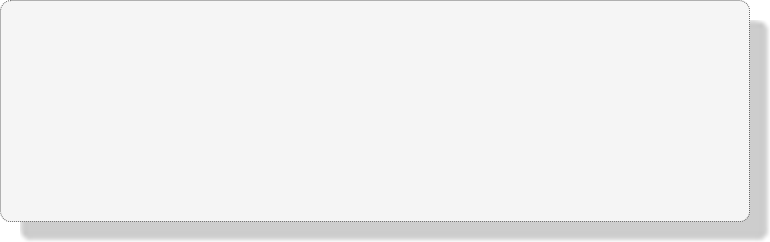
*) Schwarze Zahlen statt schwarzer Null - inzwischen hat sich das Projekt zur Erfolgsstory gemausert: 2017
besuchten mehr als 140.000 Gäste den Geysir (plus zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr), was sich in einem
Jahresüberschuss der Betreibergesellschaft von über 300.000 Euro niederschlug. Möglich wurde das durch
einen Umbau des Geysirzentrums, durch neue Ausstellungsflächen und Attraktionen. Wie heißt es so schön?
Wer sich im Ist-Zustand einrichtet, richtet sich selbst.
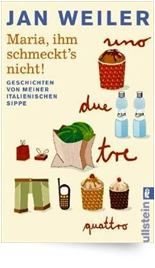
Gründerzeit für Cafés
Mensa-Blog I
Ja, gibt´s denn das?! Weil die
Mensakost "zu schlecht" ist,
haben Andernacher Schüler laut
der Rhein-Zeitung ihr eigenes
Café gegründet. Merke: Billig-
preise und Qualität schließen
sich aus, in der Schule wie im
Leben. Ernährungswissenschaft-
ler beklagen, dass Politiker statt
auf gesundes, also gutes Essen
immer noch auf die Geiz- ist-
geil-Mentalität setzen, obwohl
doch Geiz gottlos und oft auch
hirnlos ist.
Ihm schmeckt es!
Mensa-Blog II
Als der Landrat diese Zeitungs-
meldung las, verging ihm wohl
der Appetit - und kehrte erst
wieder, als er sich in der ge-
scholtenen Kantine höchst-
selbst als Testesser probierte:
"Mir hat es geschmeckt, und ich
wurde satt", gab der Kreischef
trotzig zu Protokoll, kaum dass
er Fisch, Kartoffeln und Spinat
gespachtelt hatte. Die entschei-
dende Frage lautet natürlich:
War der Besuch Saftigs angekün-
digt? Der Autor wird sich selbst
als Mystery Shopper in die Men-
sa verfügen müssen, um den
brisanten Vorwurf zu über-
prüfen...
Was erlauben sich Pfeiffer?
Mensa-Blog III
Mission impossible - dem Autor
wurde der Zutritt zur Kantine
verwehrt. Grund: Seine Verklei-
dung als Schüler flog auf. War
wohl zu sehr am Herrn "Pfeiffer
mit drei Eff" orientiert. Ein Out-
fit à la Feuerzangenbowle ist in
Zeiten von Sneakern, Destroyed
Jeans und Kapuzenpullovern
tatsächlich nicht mehr zeit-
gemäß.

"Hunderte Menschen suchen
aktuell in Andernach ein neues
bezahlbares Zuhause." Marc
Ruland, der SPD-Fraktionschef
im Stadtrat
Innerstädtische Quartiere -
die Lieblinge von Städten
und Investoren
Auf die steigende Nachfrage
nach Wohnraum in Städten ant-
wortet eine steigende Anzahl
gemischt genutzter Quartiere.
Der neue Baugebietstyp des
"Urbanen Gebietes" folgt dem
Leitbild einer Stadt "mit kurzen
Wegen, Arbeitsplätzen vor Ort
und einer guten sozialen Mi-
schung". Anders als Eigenheim-
Aggregate am Stadtrand oder
auf dem Land enthalten urbane
Quartiere geförderte und frei
finanzierte Wohnungen, wirken
sozial integrativ, ökologisch
nachhaltig und verringern dank
der Geschosswohnungen den
Flächenverbrauch.
Quartiere sind auch städtebau-
lich von Vorteil, weil sie mit neuen
Bewohnern und Erwerbstätigen
die Zentren beleben. Das Ander-
nacher Projekt am Ernestus-Platz
könnte großstädtische Vorbilder
nachahmen und wie diese zeigen:
Das fortschrittliche Wohnen der
"Urbanisten" macht die Men-
schen sozialer und entlastet die
Umwelt, das reaktionäre Woh-
nen der "Ruralisten", sprich: der
Stadtflüchter, macht die Men-
schen unsozialer und belastet
die Umwelt.
Allerdings ist Bauland in den
Innenstädten knapp. Hier sind
ostdeutsche Metropolen im Vor-
teil, deren Zentren zu DDR-Zeiten
verfielen und kaum verdichtet
wurden. Außerdem belegte die
Reichsbahn viel Platz, der jetzt
umgewandelt werden kann (wie
das RAW-Gelände im Osten von
Berlin oder der Eutritzscher Frei-
ladebahnhof in Leipzig).
Gemischt genutzte Quartiere
sind die schönsten Früchte des
"goldenen" Jahrzehnts der Im-
mobilienentwicklung, als das die
Zehnerjahre jetzt schon gelten.
Billiges Geld machte das Bauen
und den Erwerb von Bauten
leicht, ließ Projektentwickler zur
Höchstform auflaufen, indem sie
groß planen und Immobilien als
Grundsteine für ein gutes Leben
konzipieren durften. Da dies nur
mit inspirierter Architektur ge-
lingt, war die Dekade zugleich
ein Konjunktur- und Recht-
fertigungsprogramm für die
Architektenzunft.
1
2/3
4/5
6
7

8
9
Das städtische Grundstück gegenüber von Lidl (1) liegt seit Jahrzehnten brach. Der Bebauungsplan aus den 1990er-
Jahren sah hier ursprünglich Wohn- und Gewerbeimmobilien vor. Doch für das ehemalige Industrieareal ("Leim-
binderhallen") fanden sich wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet des Rheins und der Nähe zum Stromhafen,
der Lärmschutzmaßnahmen erfordert, keine Käufer. Im südlichen Teil des Geländes will nun das DRK seine neue
Zentrale bauen; in der Mitte plant die Stadt eine Kita und am Nordende ein Parkdeck für das Krankenhauspersonal,
das dem Quartier am Ernestus-Platz (2) weichen muss.
Zwischen den beiden Standorten, an der Koblenzer Straße (3), erstellt ein Bauträger ein kantiges Objekt mit exklusi-
ven Eigentumswohnungen, einem Büro und einem Ladenlokal und verdeutlicht die Attraktivität der Lage für Immo-
bilienprojekte (vor der Haustür liegt Andernachs größtes Einzelhandelsquartier). Im ehemaligen EVM-Gebäude in der
Moltkestraße (4) wollte die Stadt Sozialwohnungen einrichten. Da dort aber inzwischen Asylbewerber untergebracht
sind, fordert die SPD, den städtischen Wohnungsbau mit Hilfe des seriellen Bauens anzukurbeln. Durch den Umbau
eines Gebäudes in der Bahnhofstraße (5) hat ein einheimischer Unternehmer ein Wohn- und Geschäftshaus mit
delikater Fassade geschaffen. In dem Nachkriegsbau befand sich bis in die 70er-Jahre das Kaufhaus "Alte Post" der
jüdischen Familie Lipsky/Berg. In der Friedrichstraße (6) baute die Kreissparkasse erstmals Mietwohnungen für eigene
Mitarbeiter. Die Sparkasse beteiligte sich bereits an dem Wettbewerb um den Ernestus-Platz, was das Interesse von
Kreditinstituten an Immobilien in Zeiten von Niedrigzinsen zeigt.
An der Stelle des ehemaligen Restaurants "Zum Bollwerk" (7) an der Konrad-Adenauer-Allee errrichtet ein Bau-
unternehmer aus Miesenheim ein fünfstöckiges Haus mit Eigentumswohnungen und Stellplätzen im flutbaren
Erdgeschoss. Wenige hundert Meter weiter schlägt die Kreissparkasse erneut zu - auch wenn Baupreise und Zinsen
inzwischen kräftig gestiegen sind - und baut, wenig überraschend, ebenfalls Eigentumswohnungen (8). Dafür wurde
die letzte Fabrikantenvilla der Firma Weissheimer abgeräumt. Deutlich wird: An Andernachs "Croisette" entsteht
schon längst kein bezahlbares Zuhause mehr; den unverbaubaren Rheinblick muss man sich verdienen.
Wo (bezahlbare) Wohnungen entstehen und wo sie garantiert nicht entstehen

© 2009-2025 Wolfgang Broemser
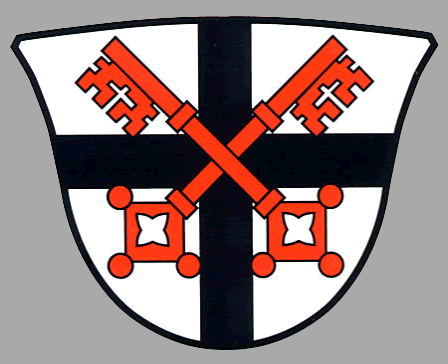
Verdienen muss man sich auch die von einem Plaidter Bauträger an der Beckstraße errichteten Wohnungen des
Projekts "Avedis" (9). Das Wort heißt so viel wie "Frohe Botschaft" - die aber nur Menschen adressiert, welche
Quadratmeterpreise von 3900 bis 4400 Euro nicht in die Flucht schlagen (vor etlichen Jahren waren das noch
Großstadtpreise).
Fazit: bezahlbarer Wohnraum in der Bäckerjungenstadt verzweifelt gesucht, wie in ganz Deutschland, wo derzeit
laut Immobilienbranche 800.000 Wohnungen fehlen. Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft - wie sie zum Bei-
spiel in Andernachs Partnerstadt Zella-Mehlis existiert - könnte ein Mittel sein, um das Ungleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage zu lindern.
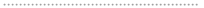
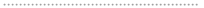
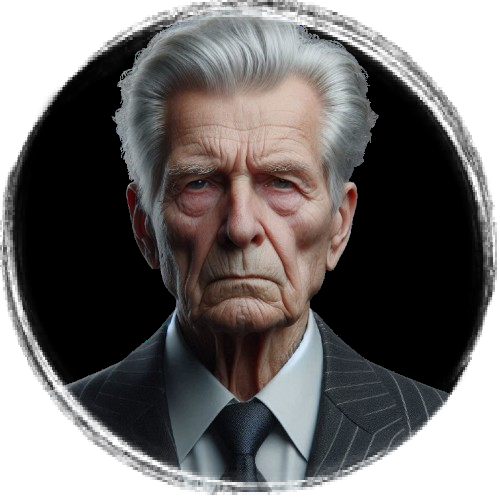
"Wie bitte? Baukunst? Das?"
So ein Hauptstadt-Architekt legt die
Latte ganz schön hoch - Berlin ist ja
auch der Hotspot zeitgenössischer
Architektur!

"Mama, darf ich
wieder bei dir
einziehen?"



"Backen wir's an!"
"Annenach bretzelt
sich auf - zum
Anbeißen!"

"Wir kriegen alles
gebacken!"



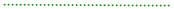
Motzki








